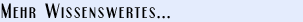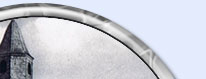Die alte Bergstadt Sontra besaß über dreihundert Jahre
das Hänselrecht.
Das "Hänseln" einen Brauch, der
jahrhundertelang in Sontra geübt wurde, führt
man zurück auf dereinst verliehene Gnand-
enerweise, Freiheiten und Privilegien sowie
auf die Zugehörigkeit zum Städteverein
der Freien Hanse.
Alle Markt-
händler mussten bestimmte
Gebräuche über sich ergehen
lassen und "Hänselgeld" bezah-
len bevor sie Mitglied der Hanse
wurden, die auch "Boschband"
oder "Baßband" hieß.
Der merkwürdige
Name kommt von "Börse". Dies war, wie
die Hanse auch eine Gesellschaft mit einer
Gemeinschaftskasse und nur wer dazu gehör-
te, durfte auf Sontras Märkten Handel treiben.
Die älteste Händlervereinigung Sontras hieß nicht
"Hanse" sondern "Boschband, Baßband, Bußband",
auch "Bußbandergesellschaft" oder "Boßbanderzunft". Die
Mitglieder waren die "Bußbandergenossen".
In "Bosch" oder "Buß" steckt das Wort Börse, mittelhochdeutsch "burse", ein Haus, das von einer aus einem gemeinsamen Beutel lebende Gesellschaft bewohnt wird; aus einer Kasse zehrende Gesellschaft von Studenten, Handwerkern, Soldaten.
Der "Boschband" war eine solche Gesellschaft. Er übte ursprünglich alle Markthänselungen in Sontra aus.
Zur Zeit des ältesten erhaltenen Hänselbuches (1572-1693) blieben auch die Sontraer Händler nicht verschont.
Jeder der auf Sontras Märkten, damals gab es in Sontra sieben große Märkte, verkaufen wollte, musste zwei Paten mitbringen und mit ihnen vor den Hänselmeister und seine beiden Knechte treten. Dort bezahlte er einen Geldbetrag und wurde von Hänselmeister in das Hänselbuch eingeschrieben.
Die erfolgte Hänselung berechtigte nur zum Verkauf einer Warenart. Wollte zum Beispiel ein Kleintuchhändler auch große Tücher verkaufen, musste er sich zusätzlich für einen Gulden in die Hanse aufnehmen lassen.
Die Hänsel-
meister wurden entweder von den Bürgermeistern oder
den Zünften eingesetzt.
Unabhängig davon wurden
alle Junggesellen, die zum ersten Mal an einer
großen Schenkhochzeit teilnahmen, gehänselt.
Damit waren sie in den Kreis der Männer
aufgenommen.
Die Schenkhochzeiten spielten in Sontra
eine große Rolle. Die Schenke war im Rathaus;
Festsaal, Küche und Küchengeräte stellte die Stadt
kostenlos zur Verfügung. Wenn ein Bürgersohn oder
Fremder eine Schenkhochzeit in Sontra beging und vor
Jahresfrist wegzog, "der sall der Stadt ein Gülden geben"
(Stadtbuch 1544). Brauteltern erhielten ein zusätzliches
Braulos und Bürgermeister und Rath stifteten mehrere Maß Wein. Für
die Tischordnung gab es landesfürstliche Vorschriften und jeder Hochzeiter musste einen "marchal" bestellen, der über den ordnungsgemäßen dreitägigen Festverlauf zu wachen hatte.
In 1775 wurde die Hanse verboten. Die Hochzeitseintragungen enden 1783, das Marktbuch wurde bis 1847 weitergeführt. Obwohl der Brauch verboten war, blieb das Wort noch lange erhalten.
Der Hänselmeister ist heute eine Symbolfigur in Sontra. Er tritt bei festlichen Veranstaltungen und bei Veranstaltungen der in 1975 neu gegründeten Hanse - Gilde Sontra auf.